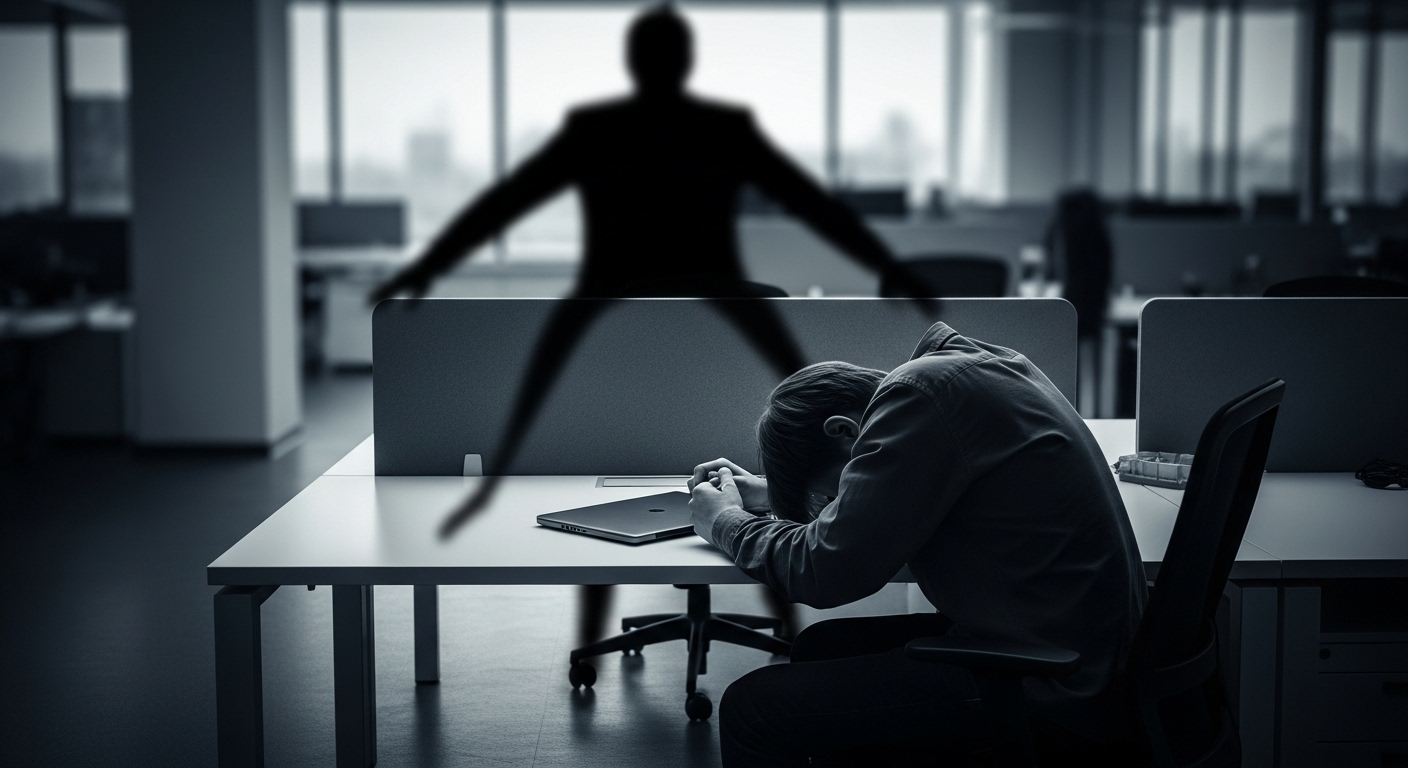Die Dynamik am Arbeitsplatz erfährt eine stetige rechtliche Weiterentwicklung, insbesondere im Bereich des Schutzes vor sexueller Belästigung. Ein jüngst ergangenes Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Köln vom 09. Juli 2025 (Az. 4 SLa 97/25) rückt die gravierenden Folgen von Geschäftsführer-Fehlverhalten und die damit verbundenen Arbeitnehmerrechte ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Diese Entscheidung, die einer Mitarbeiterin eine Abfindung von fast 70.000 Euro zusprach, weil ihr das Arbeitsverhältnis aufgrund sexistischer Übergriffe und daraus resultierender psychischer Belastungen unzumutbar geworden war, sendet ein klares Signal an Arbeitgeber und stärkt die Position von Betroffenen erheblich.
Die Definition sexueller Belästigung im Arbeitsrecht
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist weit mehr als ein Kavaliersdelikt; sie ist eine ernsthafte Verletzung der Persönlichkeitsrechte und der Würde einer Person, die schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) definiert sexuelle Belästigung in § 3 Abs. 4 als jedes unerwünschte, sexuell bestimmte Verhalten, dessen Zweck oder Wirkung es ist, die Würde der betreffenden Person zu verletzen und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld zu schaffen. Entscheidend ist dabei nicht die Absicht des Handelnden, sondern die subjektive Wahrnehmung und Wirkung des Verhaltens auf die betroffene Person. Auch subtile Annäherungen, unerwünschte Blicke, anzügliche Bemerkungen, Kommentare zum Aussehen oder sogar sexuell konnotierte Nachrichten können eine Belästigung darstellen.
Formen und Beispiele sexueller Belästigung
Die Bandbreite sexueller Belästigung ist vielfältig und reicht von verbalen über nonverbale bis hin zu physischen Übergriffen.
- Verbale Belästigung: Hierzu zählen anzügliche Witze, unangemessene Bemerkungen über Aussehen oder Privatleben, Fragen mit sexuellem Inhalt oder Aufforderungen zu sexuellen Handlungen.
- Nonverbale Belästigung: Aufdringliches Starren, Hinterherpfeifen, unerwünschte E‑Mails, SMS oder WhatsApp-Nachrichten mit sexuellem Inhalt, aber auch das Zeigen pornografischer Darstellungen fallen in diese Kategorie. Im konkreten Fall des LAG Köln 2025 Urteils spielte die Kommunikation via WhatsApp eine zentrale Rolle, in der der Geschäftsführer der Mitarbeiterin unmissverständlich sexistische und demütigende Anweisungen gab, wie sie sich zu kleiden und zu verhalten habe.
- Physische Belästigung: Unerwünschte körperliche Berührungen, Annäherungen oder sogar körperliche Gewalt sind die gravierendsten Formen.
Für Betroffene ist es unerheblich, ob sie die Unerwünschtheit des Verhaltens explizit äußern; entscheidend ist, dass der Belästiger objektiv davon ausgehen musste, dass sein Verhalten nicht erwünscht war.
Arbeitgeberpflichten und die Folgen von Fehlverhalten der Geschäftsführung
Arbeitgeber haben eine gesetzliche Schutzpflicht gegenüber ihren Beschäftigten. Nach dem AGG sind sie dazu verpflichtet, geeignete, erforderliche und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um sexuelle Belästigungen zu verhindern und auf Vorfälle zu reagieren. Dies umfasst sowohl präventive Maßnahmen wie Schulungen und die Einrichtung von Beschwerdestellen als auch repressive Schritte im Falle einer Belästigung. Wenn der Arbeitgeber seiner Schutzpflicht nicht nachkommt oder – noch gravierender – wenn das Fehlverhalten von der Geschäftsführung selbst ausgeht, kann dies weitreichende Konsequenzen haben.
Geschäftsführer-Fehlverhalten als gravierender Pflichtverstoß
Das Urteil des LAG Köln vom 09.07.2025 ist ein deutliches Beispiel für die schwerwiegenden Folgen, die Geschäftsführer-Fehlverhalten nach sich zieht. Der Geschäftsführer hatte die Klägerin wiederholt mit sexistischen, demütigenden und willkürlichen Äußerungen belästigt und seine Machtstellung missbraucht. Das Gericht stellte klar, dass ein solches Verhalten die Grenzen des für Beschäftigte Hinnehmbaren erheblich überschreitet. Arbeitgeber sind in solchen Fällen verpflichtet, arbeitsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, die von einer Abmahnung über eine Versetzung bis hin zur fristlosen Kündigung reichen können. Insbesondere bei schwerwiegenden Verstößen oder wiederholtem Fehlverhalten kann eine fristlose Kündigung auch ohne vorherige Abmahnung gerechtfertigt sein. Dies gilt umso mehr, wenn die Belästigung durch eine Führungskraft erfolgt, die eine besondere Vorbildfunktion und Schutzpflicht innehat.
Unzumutbarkeit des Arbeitsverhältnisses und hohe Abfindungen
Ein zentraler Aspekt des Kölner Urteils war die Feststellung, dass der Klägerin die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar war. Dies ist ein entscheidender Punkt im Arbeitsrecht, der es Arbeitnehmern ermöglicht, die Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung zu beantragen, selbst wenn der Arbeitgeber die Kündigungsschutzklage anerkennt. Gemäß § 9 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) kann das Gericht das Arbeitsverhältnis auf Antrag des Arbeitnehmers auflösen, wenn ihm die Fortsetzung nicht zuzumuten ist.
Im vorliegenden Fall begründete das LAG Köln die außergewöhnlich hohe Abfindung von 68.153,80 Euro (entsprechend zwei Gehältern pro Beschäftigungsjahr) mit der offensichtlichen Sozialwidrigkeit der Kündigung und der erheblichen Herabwürdigung der Klägerin. Die Abfindung erfüllte dabei nicht nur eine Ausgleichsfunktion für den Verlust des Arbeitsplatzes, sondern auch eine Genugtuungsfunktion, ähnlich dem Schmerzensgeld bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Die Gerichte können einen höheren Abfindungsfaktor anwenden, wenn das Verhalten des Arbeitgebers besonders schwerwiegend war und die Arbeitnehmerin erheblich herabgewürdigt wurde.
Schmerzensgeld und die Anerkennung psychischer Folgen (PTBS)
Das Urteil des LAG Köln hebt hervor, dass sexuelle Belästigung nicht nur direkte finanzielle, sondern auch schwerwiegende psychische Folgen haben kann. Im konkreten Fall führte das Verhalten des Geschäftsführers bei der Klägerin zu einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), die seit Mai 2024 andauerte und bei der Bemessung der Abfindung ausdrücklich berücksichtigt wurde.
PTBS als arbeitsbedingte Erkrankung
Die Anerkennung einer PTBS als Folge von Belästigung am Arbeitsplatz ist ein wichtiger Fortschritt im Arbeitsrecht und im Sozialrecht. Eine PTBS kann unter bestimmten Voraussetzungen als arbeitsbedingte Verletzung oder sogar als Berufskrankheit eingestuft werden, was für Betroffene Ansprüche auf Leistungen der Unfallversicherungsträger eröffnen kann. Die Diagnose einer PTBS erfolgt auf Basis standardisierter psychiatrischer Kriterien (z.B. ICD-10) und erfordert den Nachweis, dass die psychische Störung direkt auf ein traumatisches Ereignis oder eine traumatische Situation am Arbeitsplatz zurückzuführen ist. Die Rechtsprechung hat hier in den letzten Jahren eine wegweisende Entwicklung gezeigt, die die Bedeutung psychischer Gesundheitsschäden im Arbeitskontext unterstreicht.
Zusätzlich zur Abfindung, die eine Genugtuungsfunktion erfüllen kann, haben Betroffene unter Umständen auch Ansprüche auf Schadensersatz und Entschädigung (Schmerzensgeld) gemäß § 15 AGG für tatsächlich entstandene Schäden wie Arzt- oder Therapiekosten sowie für die erlittene immaterielle Belastung. Solche Ansprüche müssen in der Regel innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich beim Arbeitgeber geltend gemacht und gegebenenfalls gerichtlich eingeklagt werden.
Präzedenzwirkung und die Zukunft des Arbeitsrechts
Das Urteil des LAG Köln vom 09.07.2025 ist ein wichtiger Präzedenzfall. Es verdeutlicht, dass deutsche Gerichte sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, insbesondere durch Vorgesetzte, nicht tolerieren und bereit sind, hohe Entschädigungen zuzusprechen, wenn die Würde von Arbeitnehmern verletzt wird und dies zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen führt. Dies stärkt die Arbeitnehmerrechte und sendet eine klare Botschaft an Unternehmen:
- Null-Toleranz-Politik: Arbeitgeber müssen eine konsequente Null-Toleranz-Politik gegenüber sexueller Belästigung verfolgen und diese aktiv durchsetzen.
- Verantwortung der Führungsebene: Das Fehlverhalten von Geschäftsführern oder Vorgesetzten wird besonders streng bewertet und führt zu empfindlichen Konsequenzen.
- Schutz psychischer Gesundheit: Die psychische Gesundheit der Beschäftigten, einschließlich der Vermeidung von PTBS, muss einen hohen Stellenwert in der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers einnehmen.
Diese Entscheidung trägt dazu bei, das Bewusstsein für die Schwere sexueller Belästigung zu schärfen und die Arbeitswelt sicherer und gerechter zu gestalten. Sie ermutigt Betroffene, sich zur Wehr zu setzen, und verpflichtet Arbeitgeber, ihrer Verantwortung umfassend nachzukommen.
Fazit
Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln vom 09. Juli 2025 markiert einen entscheidenden Meilenstein im deutschen Arbeitsrecht. Es bekräftigt eindringlich, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, insbesondere durch Führungskräfte, nicht geduldet wird und massive rechtliche sowie finanzielle Folgen für die Arbeitgeber haben kann. Die Zuerkennung einer hohen Abfindung, die auch eine Genugtuungsfunktion für die erlittene Persönlichkeitsrechtsverletzung und die Ausbildung einer posttraumatischen Belastungsstörung umfasst, unterstreicht die wachsende Bedeutung des Schutzes der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Arbeitgeber sind mehr denn je gefordert, präventive Maßnahmen zu ergreifen und auf Vorfälle konsequent und angemessen zu reagieren, um ein respektvolles und sicheres Arbeitsumfeld für alle Beschäftigten zu gewährleisten. Dieses Urteil ist ein starkes Signal für die Stärkung der Arbeitnehmerrechte und setzt einen wichtigen Präzedenzfall für zukünftige Fälle sexueller Belästigung.
Weiterführende Quellen
https://www.lag-koeln.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen/05_18_07_25/index.php